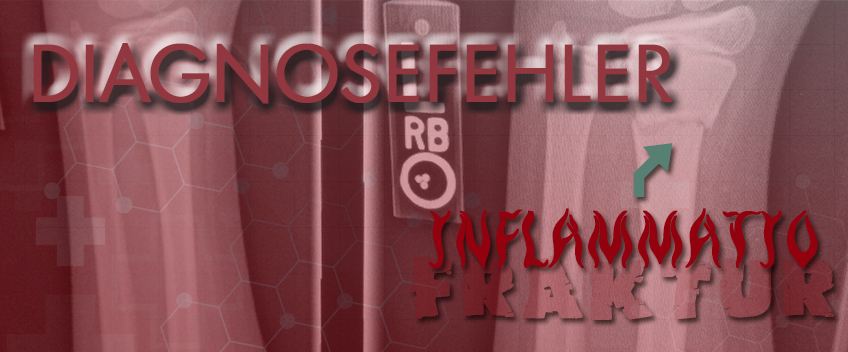Die Rechtsprechung hat wiederholt darauf hingewiesen, dass Diagnosefehler nur zurückhaltend als Behandlungsfehler gewertet werden dürfen, beispielsweise nur dann, wenn die falsche Diagnose eine unvertretbare Fehlleistung darstellt. Dies wird damit begründet, dass nach der Schilderung des Patienten und durchgeführten Untersuchungen eine Abgrenzung oft schwierig ist, weil die erhobenen Befunde durchaus verschiedene Ursachen haben können.
Anders werden Befunderhebungsfehler beurteilt. Diese führen deutlich häufiger zur Arzthaftung.
Welche Fehldiagnosen und falsche Reaktionen auf erhobene Befunde als Behandlungsfehler anerkannt wurden, sehen Sie an den folgenden Beispielen aus meiner Anwaltskanzlei:
Erhebliche Dislokation einer Radiustrümmerfraktur wegen zu schmal gewählter Osteosyntheseplatte - 25.000,00 € Entschädigung
Der Mandant war auf Arbeit von einer Leiter gestürzt und hatte dabei versucht, sich mit der linken Hand abzustützen. Mit einer massiv geschwollenen linken Hand, sowie Schmerzen in der Schulter wurde er von einem Arbeitskollegen ins Krankenhaus am Arbeitsort gefahren. Dort wurde die Diagnose Radiusfraktur gestellt und er bekam ein Schmerzmittel als auch eine Schiene.
Da das Krankenhaus für Arbeitsunfälle nicht zugelassen war, erfolgte die weitere Behandlung in einem wohnortnahen Krankenhaus mittels Aushängen am Mädchenfänger (Extensionshülse). Unter heftigsten Schmerzen wurde eine Gipsschiene angelegt. Einige Tage später wurde die operative Behandlung durch offene Reposition und Plattenosteosynthese durchgeführt und eine Nachbehandlung für 3 Wochen in der Schiene empfohlen.
Bei der ambulanten Weiterbehandlung stellte sich zunächst ein Taubheitsgefühl an 3 Fingern ein. Mit der Diagnose Karpaltunnelsyndrom folgte eine weitere Operation zur Metallentfernung und fast ein Vierteljahr eine Fixateur externe-Behandlung und letztlich eine Versteifung des Handgelenkes. Da er Linkshänder war, mit der Hand nicht mehr greifen konnte und ständig Schmerzen im Handgelenk hatte, waren die Folgen für den Betroffenen verheerend, denn er konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben.
Eine Überprüfung durch die Gutachterstelle der Sächsischen Landesärztekammer ergab, dass nach dem unnötig brüsken Repositionsmanöver zwar ein modernes, aber zu schmales Implantat gewählt worden war, welches mit nur einer Schraube das ulnare Fragment gerade so erfasste. Dies war auf der bildgebenden Diagnostik ersichtlich, wurde aber nicht erkannt. Dadurch kam es zu der Verschiebung der Fragmente und wegen der Instabilität wurde auch noch eine Ruhigstellung für weitere 3 Wochen in der Schiene empfohlen, die wiederum zu einer Inaktivitätsosteoporose führte (schlechte Knochenbeschaffenheit durch Entkalkung). Beides wäre bei standardgerechter Behandlung nicht passiert, auch wenn der Sachverständige im Schlusssatz relativierend einschätzt, dass mit Erkennung der Bandinsuffizienz und einer besseren Fassung der Osteosynthesematerialien „unter Umständen“ eine Sekundärdislokation hätte vermieden werden können.
Die Landesärztekammer Sachsen empfahl mit Bescheid vom 18.03.2011 der Haftpflichtversicherung des Krankenhauses, den Anspruch hinsichtlich der Schäden an der linken Hand anzuerkennen. Mit diesem Bescheid kam der Mandant zu mir, da seitens der Versicherung nach einer Mitteilung, das Gutachten sei so eindeutig nicht und der Patient in der Beweislast, keine Reaktion mehr erfolgte.
Für die erlittenen Schmerzen, die Folgeoperation und die bleibende Bewegungseinschränkung wurde letztlich außergerichtlich ein Entschädigungsbetrag in Höhe von 25.000,00 € vereinbart, der ohne anwaltliche Vertretung nicht erreichbar gewesen wäre.
Schwerer hypoxischer Hirnschaden bei Spontangeburt aus Beckenendlage, verstorben nach 3½ Monaten an schweren Sekundärschäden - 12.000,00 € Abfindung
Nach einem Gutachten des MDK Sachsen besteht bei einer Beckenendlage ohnehin ein erhöhtes Risiko für eine intrapartale Hypoxie des Fötus. Schäden des Kindes sind dadurch zu vermeiden, dass die Entwicklung ab dem kritischen Punkt der Entbindung (nach der Geburt des unteren Winkels des vorderen Schulterblatts) zügig erfolgt.
Laut Gutachter gab es gleich mehrere ärztliche Sorgfaltspflichtverletzungen:
-
CTG-Auffälligkeiten und eine ausgeprägte mütterliche Tachykardie wurden nicht ausreichend berücksichtigt
-
eine relevante Hypoxiephase des Fötus wurde fehlerhaft nicht erkannt, weil die Herztöne der Mutter fälschlicherweise als die des Kindes interpretiert wurden
-
dadurch war in der kritischsten Phase der Entbindung die effektive Überwachung des Fötus nicht gewährleistet
-
und eine rechtzeitige sekundäre Sectio, die das Kind noch hätte retten können, wurde der Kreißenden nicht vorgeschlagen.
Den Fötus korrekt zu überwachen, stellt ein voll beherrschbares Risiko dar. Durch die Fehleinschätzung wurde die klinisch relevante Hypoxie des ungeborenen Kindes nicht rechtzeitig erkannt. Das Argument der Haftpflichtversicherung der Klinik, man könne die Herztöne von Mutter und Kind schon mal verwechseln, wurde in einem Ergänzungsgutachten ausgeräumt. Der Sachverständige stellte fest, dass außerdem noch nicht mal aufgefallen war, dass auf dem CTG-Streifen nur noch die mütterliche Frequenz aufgezeichnet wurde. Der Schallkopf für die Aufzeichnung der fetalen Herzfrequenz war abgegangen. Eine Auskultation mit einem einfachen Holzrohr wie früher wäre daher geboten und durchführbar gewesen.
An den schweren bei der Geburt erlittenen Schäden verstarb das Kind nach 3½ Monaten.
Bei den anschließenden Verhandlungen mit der Haftpflichtversicherung kam das Gegenargument, dass das Kind aufgrund des Hirnschadens kaum etwas davon mitbekommen habe. Dieser Einwand zielt darauf ab, dass Heftigkeit und Dauer der erlittenen Schmerzen und Leiden für die Höhe des Schmerzensgeldes maßgeblich sind. Denn nach der bisherigen, derzeit (noch) geltenden Rechtsprechung rechtfertigen weder der Tod an sich, noch die Verkürzung der Lebenserwartung, ein Schmerzensgeld.
Mit den Behandlungsunterlagen und Zeugenaussagen konnte nachgewiesen werden, dass das Baby durch tiefes Stöhnen signalisierte, dass es sein Leiden gespürt hat. Die fehlerhafte Überwachung des Kindes bei der Geburt war ein Befunderhebungsfehler, was letztlich zu der außergerichtlichen Einigung vom 15.08.2012 führte.
Denn auch einfache Befunderhebungsfehler führen zu einer Beweislastumkehr hinsichtlich der Kausalität des Behandlungsfehlers für den Schaden, wenn sich bei gebotener Abklärung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein reaktionspflichtiges positives Ergebnis gezeigt hätte und sich eine Nichtreaktion darauf als grob fehlerhaft darstellen würde (vgl. BGH Urteil v. 13.09.2011, AZ: VI ZR 144/10).
Für die Abgrenzung von Befunderhebungsfehler und Diagnosefehler und die Einschätzung, ob auch vorliegende fehlerhafte Diagnosen einen Behandlungsfehler darstellen, der zur Arzthaftung führt, ist ein Anwalt für Medizinrecht der richtige Ansprechpartner.